MILLA - „Modulares Interaktives Lebensbegleitendes Lernen für Alle“
Der Arbeitskreis Zukunft der Arbeit in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion stellte das Konzept unter dem Titel „Die Weiterbildungswende“ am 5. November 2018 auf der Bundesvorstandsklausur der CDU in Berlin vor. Der in vielen Foren daraufhin aufbrandende Diskurs um das "Für und Wider" zeigt die verschiedenen Perspektiven und Blickwinkel, aus denen das Projekt betrachtet werden kann.
An dieser Stelle möchten wir die Beiträge sammeln und Ihnen zur Verfügung stellen. Für den Diskurs steht Ihnen das wb-web-Forum offen. Hier finden Sie bereits erste Stellungnahmen. Sie sind herzlich zur Teilnahme am Austausch eingeladen. Gern nehmen wir weitere Beiträge in unsere Sammlung auf. Bitte schicken Sie den entsprechenden Link an die Redaktion.
wb-web-Forum zu Milla
Diskutieren Sie mit Vertretern aus der Erwachsenenbildung, der Wissenschaft, der Politik und allen weiteren Interessierten das Thema "Milla" in unserem wb-web-Forum!
Wer setzt welche Standards?
09.10.2020 . "Fragen über Fragen" - Jochen Robes setzt sich in seinem Blog zu dem geplanten "Netflix für die Online-Bildung" mit den Anforderungen an so ein Portal auseinander wie auch mit den Auswirkungen auf bestehende Strukturen. Der Autor siehr viele Fragen unbeantwortet. Wenn eine neue zentrale Plattform über eine zentrale Linkplattform hinaus geht, KI Kompetenzen automatisch eingestuft und geprüft werden, Tests, Empfehlungen und Lernangebote passend angeboten werden, dann braucht es Standards. Diese Standards regeln Service-, Sicherheits- und Qualitätskriterien sowie die Gewährleistung rechtlicher und geschäftlicher Standards.
Lesen Sie hier den vollständigen Beitrag: Ein „Netflix“ für die Online-Bildung? Brauchen wir in Deutschland „eine bundesweite Bildungsplattform für alle“ – und wie könnte diese aussehen?
Die DGWF nimmt Stellung zu MILLA - Die digitale Lernplattform
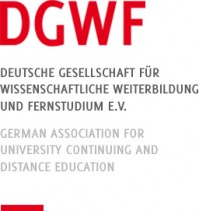
Logo nicht unter freier Lizenz
Die DGWF hat die Initiative des Arbeitskreises Zukunft der Arbeit in der CDU/CSU Bundestagsfraktion der digitalen Plattform MILLA „Modulare Interaktive und Lebensbegleitende Lernen für Alle“ mit Interesse zur Kenntnis genommen und bietet für diese gesamtgesellschaftliche Diskussion ihre Experise an.
Die DGWF hat die Initiative des Arbeitskreises Zukunft der Arbeit in der CDU/CSU Bundestagsfraktion der digitalen Plattform MILLA „Modulare Interaktive und Lebensbegleitende Lernen für Alle“ mit Interesse zur Kenntnis genommen und bietet für diese gesamtgesellschaftliche Diskussion ihre Experise an.
Mit großem Interesse hat die DGWF die Initiative des Arbeitskreises Zukunft der Arbeit in der CDU/CSU Bundestagsfraktion zur Kenntnis genommen, mit der digitalen Plattform MILLA das „Modulare Interaktive und Lebensbegleitende Lernen für Alle“ fördern zu wollen. Die DGWF teilt mit den Projektverantwortlichen die Einschätzung, dass es vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, des Fachkräftemangels und angesichts der erheblichen Veränderungen des Arbeitsmarktes durch die Folgen der Digitalisierung exponentiell erhöhter Anstrengungen und Investitionen bedarf, um die anstehenden Arbeitsmarkt-, Qualifikations- und Bildungsanforderungen zu bewältigen.
Alle Weiterbildungsanbieter sind heute gefordert, sich dieser Aufgabe mit Blick auf die jeweils von ihnen zu verantwortenden Felder anzunehmen und das Angebot durch Bildungsmaßnahmen zu bereichern, die qualitativ hochwertig und passgenau für die adressierten Zielgruppen sind. Das gilt für die wissenschaftliche Weiterbildung im engeren Sinn und für die hochschulische Weiterbildung, die wissenschaftliches Wissen berufsbegleitend zugänglich macht bzw. deren Angebote von Akademiker*innen und beruflich qualifizierten Personen weiterbildend genutzt werden können.
Die DGWF ist allerdings skeptisch, ob MILLA als ein überaus ambitioniertes Projekt dem Anspruch, Weiterbildung für Alle zugänglich zu machen, gerecht werden kann. Insbesondere das Anliegen, weniger weiterbildungsaffine Personengruppen an (Weiter-)Bildung heranzuführen, dürfte sich kaum durch den Einsatz noch so smarter Technik lösen lassen. Das Bund-Länder-Programm „Aufstieg durch Bildung: Offene Hochschulen“ hat hier wegweisende Ergebnisse für den Hochschulsektor vorgelegt und gezeigt, welche Anstrengungen in der Vorbereitung und im Übergang in ein Studium zur Unterstützung der sogenannten nicht-traditionellen Studierendengruppen vonnöten sind. Digitale Technik kann hierbei unterstützend eingesetzt werden, sie ist jedoch nicht der Problemlöser per se.
Die Schaffung eines Megaportals (das „Netflix“ der Weiterbildung?) kann aus Sicht der DGWF die adressierten Probleme und Herausforderungen nicht lösen. Nach Auffassung der DGWF ließen sich die bezifferten Finanzmittel für MILLA weitaus besser für ein bundesweites nachhaltiges Förderprogramm nutzen, das Anbieter zur Entwicklung bedarfsgerechter und passgenauer Bildungsprogramme und Bildungs-wege quer zu den bestehenden Sektoren befähigt, Interesse an einer Kultur des Lernens weckt und den Menschen die Chance gibt, sich für die berufliche Zukunft fit zu machen.
Für diesen gesamtgesellschaftlich überfälligen Diskussions- und Entscheidungsprozess stellt die DGWF gerne ihre Expertise zur Verfügung.
Autor: Daniel Haines Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, DGWF
Quelle: Pressemitteilung DGWF vom 25.02.2019
Milla will vor allem eines: schnell sein

Eine Arbeitsgruppe der CDU-Bundestagsfraktion rund um Thomas Heilmann hat zu einem Expertenaustausch in den Deutschen Bundestag eingeladen, bei dem ihr Konzept MILLA im Fokus steht. MILLA steht für „Modulares Interaktives Lebensbegleitendes Lernen für Alle“ und ist in den Fachmedien schon recht breit diskutiert worden. Verantwortlich sind für das Konzept die Abgeordneten Thomas Heilmann, Marc Biadacz, Antje Lezius und Kai Whittaker. Dr. Peter Brandt schildert seine Eindrücke aus dem Austausch.
MILLA - Die Weiterbildungswende
Wer oder was ist MILLA? Hier finden Sie die Veröffentlichungen zu der Vorstellung des Projekts.
- MILLA - Die Weiterbildungswende
Bundesvorstandsklausur der CDU, 5.11.2018 - MILLA – Die Weiterbildungswende
Geplanter Antrag der Kreisverbände Bad Kreuznach, Böblingen, Rastatt und Steglitz-Zehlendorf an den 31. Bundesparteitag der CDU Deutschlands - CDU/CSU Bundestagsfraktion
Weiß: Neue Wege in der Weiterbildung - Neue E-Learning-Plattform: CDU will Weiterbildung grundlegend umkrempeln
- MILLA - Präsentation 5. November 2018, Arbeitskreis Zukunft der Arbeit in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
Drei Fragen an MILLA
Vor dem Hintergrund einer vor einigen Monaten durchgeführten Machbarkeitsstudie für eine "(Inter-)Nationale Plattform für die Hochschullehre" betrachtet Dr. Ulrich Schmid, mmb Institut, MILLA anhand der folgenden drei Fragen:
- Wie umgehen mit der Heterogenität des digitalen Lernens?
- Was wenn zu wenige oder zu viele Inhalte zu bestimmten Themen angeboten werden?
- Wer kann MILLA (kostenlos) nutzen und was bedeutet das für den Weiterbildungsmarkt.
Als Fazit sieht Schmid MILLA als Idee lobenswert und ambitionert, aber er sieht in dem aktuellen Entwurf keinesfalls eine Art "Netflix" oder Spotify".
"Im Gegenteil: Ich fürchte, dass dabei am Ende eher etwas herauskäme, das an ein "eGovernment"-Portal einer durchschnittlichen deutschen Großstadt erinnert."
Der Beitrag ist zuerst auf www.digitalisierung-bildung.de erschienen. Sie können ihn auch hier lesen.
Und täglich grüßt die Super-Plattform

Logo nicht unter freier Lizenz
Die Idee von der freien, vernetzten Bildung im Netz trifft auf unbeirrbare Vorstellungen vom Lernen auf großen Plattformen. Doch die erscheinen dem Kolumnisten Markus Deimann zunehmend als lernfeindliche Orte, ohne Raum für spielerisches Entdecken.
Kompetenzpunkte, Skilltainment, Kontrolle des angedachten Systems MILLA geben ihm zu denken. Die Plattformen bewirken, so Deimann, das Gegenteil von dem, wie man sich ursprünglich die digitale Gesellschaft vorgestellt hat:
"Auf Plattformen werden Bildungspotenziale systematisch entfernt und durch Programmierung ersetzt. Freiheit wird durch Kontrolle ersetzt. Fragen durch Antworten."
Für den Autor fehlen neben technischen Alternativen insbesondere alternative Bildung. "Ziel sollte nicht sein, die Strukturen der analogen Welt in das Digitale hinüberzuretten."
Hier können Sie die ausführliche Kolumne lesen.
Was will MILLA?

Diese Frage stellte Dr. Jan-Martin Wiarda Professor Bernd Käpplinger für seinen Blog. MILLA steht auch als Synonym für einen Zentralismus in Weiterbildungsfragen, den man bislang so von der Union nicht kannte.
Wo bis heute der Markt die Weiterbildung regelt, soll jetzt die vom Bund kontrollierte Webseite steuern und verwalten. Doch zurecht fragt man: Wollen Arbeitgeber und Gewerkschaften eine solche Plattform? Selbst die Arbeitgeber haben auffallend zurückhaltend reagiert. Auch ist MILLA nicht die erste Weiterbildungsdatenbank. So gibt es bereits ein Angebot an Weiterbildungsdatenbanken, die überregional Interessenten Kursangebote präsentieren und für den Weiterbildungssuchenden durchaus Ordnung in den – politisch gewollt – zerklüfteten Weiterbildungsdschungel bringen.
Wird MILLA ein Datenmonster? Wenn Bildungsprämien und Bildungsgutscheine direkt über die Buchung eines Kurses auf der Datenbank mit persönlicher Zuordnung erfolgt, was passiert dann mit den Daten?
Hier stellt sich auch die Frage: "Wie positioniert sich der Staat? Lässt er die privaten Player unreguliert agieren, oder erhebt er einen Gestaltungsanspruch und strukturiert das Angebot neu? In welchem Ausmaß lässt er sich dabei von kommerziellen Agenturen unterstützen?"
Bernd Käpplinger ist Professor für Weiterbildung an der Universität Gießen und Vorsitzender der Sektion Erwachsenenbildung in der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft.
Jan-Martin Wiarda ist seit 2015 freier Journalist, Autor, Moderator. Zuvor war er als Redakteur in Hamburg bei der ZEIT im Bildungsressort "Chancen" und drei Jahre als Kommunikationschef der Helmholtz-Gemeinschaft tätig.
Lesen Sie das ganze Interview auf dem Blog von Dr. Jan-Martin Wiarda.
Quelle: Blog von Dr. Jan-Martin Wiarda.
»Wir dürfen nicht in Schubladen denken«

Anja Karliczek, Bundesministerin für Bildung und Forschung (Bild: © Bundesregierung/Guido Bergmann)
Bundesministerin Anja Karliczek betonte im Interview für das Journal des Deutschen Studentenwerks (4/2018) noch einmal die angestrebte Modularisierung der Weiterbildung sowie deren Verzahnung mit der wissenschaftlichen Aus- und Weiterbildung an Hochschulen.
"Wir wollen, dass sich auch die Hochschulen mit den Unternehmen zusammentun und gemeinsam Weiterbildungskonzepte entwickeln. Es geht um eine Verzahnung der Systeme." Laut Karliczek soll die Modularisierung insbesonderen Berufstätigen dabei entgegenkommen und berufsbegleitende Maßnahmen ermöglichen.
Lesen Sie das ganze Interview in der Online-Ausgabe DSW Journal 4/2018.
Das Interview führten der Journalist und Blogger Jan-Martin Wiarda und Achim Meyer auf der Heyde, Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks.
Quelle: DSW Journal 4/2018.
Wuppertaler Kreis: Stellungnahme

Logo Wuppertaler Kreis nicht unter freier Lizenz
Der Bildungsspiegel veröffentlichte die Stellungnahme des Wuppertaler Kreises. Neben der Beschreibung der Eckpunkte in dem Positionspapier finden Sie dort die Stellungnahme des Wuppertaler Kreises. Das folgende Fazit finden Sie auch auf der Seite des Bildungsspiegels.
Fazit des Wuppertaler Kreises
Es ist ein positives Signal, dass die CDU/CSU-Bundestagsfraktion Ideen entwickelt, die den Fokus auf die Weiterbildung in Deutschland legen.
Gleichzeitig ist deutlich erkennbar, dass der vorgelegte Vorschlag für eine gesamtgesellschaftliche Innovation in seiner Gestaltung nicht als umsetzungsreifes Konzept einer neuen staatlichen Institution, sondern eher als ein Impuls oder eine Idee zu werten ist, die noch erheblicher Realitätsprüfung und Abstimmung mit Strukturen der Weiterbildung bedarf.
Das Diskussionspapier ähnelt von seiner Argumentationsweise und Darstellung einer Produktidee für ein Startup-Unternehmen. Von einem Konzept, mit dem neue soziale Kontrollinstanzen und weitreichende marktregulierende Eingriffe wie die vorgeschlagenen „Kompetenzpunkte“ und die staatliche Regulierung von Angeboten seriös begründet werden, ist dieses Diskussionspapier qualitativ weit entfernt.
Es enthält darüber hinaus auch Vorschläge, die – zu Ende gedacht – in eine Richtung führen würden,die aufgrund ihres weitreichenden Eingriffs in Persönlichkeitsrechte und die Freiheit des Marktes unbedingt zuerst auf ihre gesellschaftliche Akzeptanz überprüft und einer Realitätsüberprüfung unterzogen werden müssten, und nicht zuletzt einer demokratischen Legitimation bedürfen.
Drei Punkte sind hier in erster Linie zu nennen:
- Mit dem Aufbau eines staatlichen Bildungsportals, in dem Bürger Kompetenzpunkte für die Teilnahme an Weiterbildung erwerben können, die dann auch als „digitale Währung“ z.B. am Arbeitsmarkt dienen können, sollte eine deutliche Abgrenzung gegenüber den digitalen Konzepten nicht-demokratischer Staaten aufrechterhalten bleiben, die die soziale Kontrolle ihrer Bürger im Blick haben. Die für Bürgerinnen und Bürger unübersichtliche Datensammlung der Internet-Konzerne sollte nicht in einer staatlichen Institution fortgesetzt werden.
- Die Vorstellung, dass eine staatliche Stelle die Qualität von Weiterbildungsangeboten bewertet und damit den Wert von Qualifikationen beziffert und Weiterbildungsangebote ausschließt ist ein erheblicher Eingriff in den Markt für Bildungsdienstleistungen, der durch den Wunsch nach Transparenz nicht gerechtfertigt wird. Ein derartiger Eingriff in einen funktionierenden und pluralen Markt für wissensbezogene Dienstleistungen ist in einer Marktwirtschaft nicht akzeptabel.
- Das Modell sieht vor, dass die Nachfrage nach Bildung staatlich definiert wird, indem eine staatliche Stelle relevante Fähigkeiten identifiziert und evaluiert. Die Bildungsanbieter können dann dazu Angebote bereitstellen, die den Bürgern angeboten werden. Die Anbieter und Angebote werden durch ein staatliches Kuratorium überprüft und zertifiziert. Es geht hier ausdrücklich nicht um die Bedarfe der Unternehmen, sondern die Bildungsbedarfe werden von einer unabhängigen Kommission definiert. Der Annahme, dass auf diese Weise der beklagte „Mismatch“ zwischen betrieblich erforderlichen Fähigkeiten und erworbenen Qualifikation besser als bisher verhindert würde, ist mit großer Skepsis zu begegnen.
Gleichzeitig enthält dieses Diskussionspapier auch gute Anregungen, die aktuelle Trends in der Weiterbildung aufnehmen und laufende Schritte der Digitalisierung in der Weiterbildung benennen, z.B. der Fokus auf kurze, lösungsorientierte und arbeitsplatznahe Angebote, die unter dem Begriff „Bildung on demand“ diskutiert werden. Auch die Schaffung digitaler Anreize für Bildung durch Wettbewerb spielt unter der Überschrift „Gamifikation“ in der beruflichen Weiterbildung eine Rolle. Gerade bei multiplizierbaren und wenig individualisierten Lerninhalten (z.B. Fremdsprachen) sind schon heute Online-Angebote weit verbreitet.
Auch die Idee, eine Lernplattform-Infrastruktur anzubieten, die von Unternehmen, Verbänden, Netzwerken und Beschäftigten genutzt werden könnte, um Bildungsinhalte zu organisieren und anzubieten, geht in die richtige Richtung.
Aus Sicht des Wuppertaler Kreises sollten bei einer möglichen weiteren Diskussion dieser Ideen folgende Leitgedanken im Vordergrund stehen:
- Es gibt im staatlichen Verantwortungsbereich noch erheblichen Handlungsbedarf, wenn es darum geht, im Bereich der Bildung Grundlagen für eine erfolgreiche digitale Transformation zu legen. Hier sollte der Fokus des staatlichen Gestaltens liegen, nicht in der Regulierung eines Marktes, der im Wesentlichen gut funktioniert.
- So sehr es Sinn macht, mit nationalen Plattformen den großen Internet-Konzernen gerade im Bereich der Bildung eine eigene Position entgegenzusetzen, sollte es gut überlegt sein, ob diese Plattformen in Form einer staatlichen Infrastruktur entwickelt werden sollten. Stattdessen schlägt der Wuppertaler Kreis vor, eine Plattform für Bildungsangebote in privater Trägerschaft zu entwickeln, die den Zugang zu den breit angelegten Angeboten, die bereits vorhanden sind, erleichtert und zum Lernen motiviert.
- Der Staat sollte nicht den Fehler machen, sich eine Qualitätsüberprüfung im frei finanzierten Weiterbildungsmarkt anzumaßen und entsprechende Kommissionen einzurichten, die inhaltlich regulierend in die Formulierung von Bildungsbedarfen eingreifen. Es gibt keinen Anlass die Qualität der Personalentwicklung in den Unternehmen zu bezweifeln und hier eine staatlich-paternalistische Definitition von Anforderungen vorzusehen. Hier sollte stattdessen das Prinzip des Vertrauens in die regulierende Funktion eines funktionierenden Marktes gelten.
Quelle: Bildungsspiegel
Kritik an "Milla": Eine Plattform macht noch keinen Lerner
Gudrun Porath sieht in ihrer Analyse die Initiative kritisch. Denn, schon heute hat jeder Bürger / jede Bürgerin mit einem Smartphone, Tablet oder einem anderen Internetzugang die Möglichkeit im Netz Weiterbildungsangebote zu recherchieren und sich anzumelden. So ist es aus ihrer Sicht weniger die fehlende Infrastruktur sondern der Lernunlust geschuldet, dass sich aus Sicht der Politik zu wenige Menschen an Weiterbildungsmaßnahmen beteiligen.
"Womöglich fehlt uns - gesamtgesellschaftlich gesehen - eine entsprechende Lernkultur, die Lust auf Lernen macht und zu persönlicher Weiterentwicklung motiviert, diese auch anerkennt. Vielen Menschen erscheint es nicht erstrebenswert, sich weiterzubilden und in persönliche Kompetenzen zu investieren, wenn sie nicht gerade Schüler, Studenten oder Auszubildender sind.
Wer Zeit in persönliche Bildung investiert, muss sich unter Umständen sogar dafür rechtfertigen. Ganz egal, ob es sich dabei um digitale oder andere Kompetenzen handelt. Andere haben es nicht gelernt, selbstgesteuert zu lernen. Daran wird auch eine staatlich kontrollierte, zentrale Weiterbildungsplattform mit noch so vielen, wie es im Konzept heißt, „Skilltainment“-Angeboten nichts ändern. Eine Plattform macht noch keinen Lerner."
Quelle: Kritik an "Milla": Eine Plattform macht noch keinen Lerner
Payback-Punkte fürs Lernen
Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann will die Deutschen animieren, sich stärker fortzubilden. Wer relevante Kurse belegt, wird belohnt - der Staat soll das mit Milliarden finanzieren. Welche Kurse relevant sind, definiert der Staat.
Finanziert werden soll das System aus Steuern; auf ein bis drei Milliarden Euro im Jahr schätzt Heilmann die Kosten. Die Kurse an sich sollen kostenlos sein; die Anbieter wiederum bekommen für ihre Leistungen Geld. Wie viel, das soll sich unter anderem danach richten, wie arbeitsmarktrelevant ihr Kurs ist und wie gut er von den Nutzern bewertet wird. Was als relevante Fähigkeiten gilt, wird fortlaufend staatlich ausgewertet und veröffentlicht.
Quelle: Henrike Roßbach, Payback-Punkte fürs Lernen. IN Süddeutsche Zeitung




